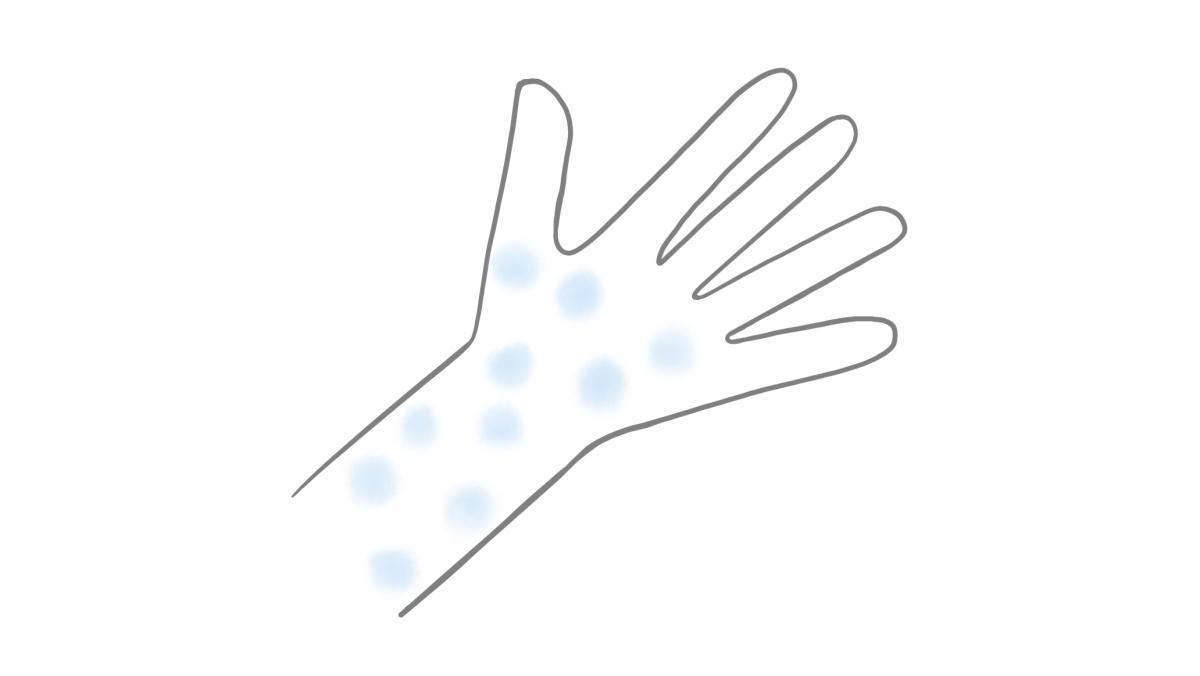Was ist Urtikaria?
Urtikaria ist eine häufige Hauterkrankung, die durch Mastzellaktivierung entsteht und sich durch Quaddeln und/oder Angioödeme äußert.
Die Quaddeln sind typischerweise juckend, scharf begrenzt, erhaben und verschwinden innerhalb von 24 Stunden. Angioödeme sind tiefere Schwellungen, vor allem an Augenlidern, Lippen oder Extremitäten. Sie sind oft schmerzhaft und persistieren länger, in der Regel bis zu 72 Stunden.
Klassifikation nach Dauer und Ursachen
- akute Urtikaria: Dauer < 6 Wochen (Hauptursache: Virusinfektionen)
- chronische Urtikaria: Dauer > 6 Wochen, unterteilt in:
- chronisch spontane Urtikaria (CSU): spontane Symptome ohne erkennbare Trigger
- chronisch induzierbare Urtikaria (CindU): Trigger sind spezifisch und reproduzierbar, z.B. Kälte, Druck, Wärme oder Sonnenlicht
Wann besteht Handlungsbedarf?
Bei der akuten Urtikaria sind sofortige Maßnahmen erforderlich bei:
- Atemnot, Engegefühl im Hals oder Schwellung der Zunge (Verdacht auf Anaphylaxie! Notruf 112!)
- Angioödemen im Gesicht oder an Schleimhäuten mit drohender Atemwegsverlegung
- Allgemeinsymptomen wie Fieber, Schwindel, Kreislaufproblemen oder Bewusstseinsstörungen
Kein Handlungsbedarf besteht, wenn es sich um selbstlimitierende, kurze Episoden ohne begleitende Allgemeinsymptome handelt und das Kind in gutem Allgemeinzustand ist.
Bei der chronischen Urtikaria ist eine Abklärung erforderlich bei:
- Dauer der Symptome > 6 Wochen
- täglichen oder häufig wiederkehrenden Quaddeln mit erheblicher Beeinträchtigung des Alltags
- unklarem Verlauf trotz Beobachtung und dokumentierter Auslöser
Kein Handlungsbedarf besteht bei leichten, selten auftretenden Beschwerden ohne Beeinträchtigung.
Diagnostik
Die Diagnostik sollte gezielt und ressourcenschonend erfolgen (so wenig wie möglich, so viel wie nötig!). Gemäß der S3-Leitlinie ist die Anamnese das wichtigste Instrument.
Anamnese:
- Beginn und Dauer der Symptome: Wann treten die Beschwerden auf?
- Aussehen und Dauer der Quaddeln: Flüchtigkeit (< 24 Stunden?)
- Triggerfaktoren: Infekte, Lebensmittel, Medikamente, physikalische Reize (Druck, Kälte, Wärme)
- Begleitsymptome: Atemnot, Bauchschmerzen, Fieber, Schwellungen
- vorherige Behandlungen: Wirksamkeit von Antihistaminika?
Körperliche Untersuchung:
- Hautbefund: Lokalisation, Größe und Verteilung der Quaddeln und Angioödeme
- Allgemeinzustand: Fieber, Lymphknotenschwellungen, Schleimhäute
Weiterführende Diagnostik: nur bei chronischer Urtikaria oder schwerem Verlauf. Es wird empfohlen, zunächst eine begrenzte Anzahl von Untersuchungen durchzuführen.
- Basisuntersuchung: Differenzialblutbild, CRP und/oder BSG
- In der spezialisierten Versorgung wird empfohlen, zusätzlich folgende Parameter zu bestimmen: Gesamt-IgE, IgG-Anti-TPOs, ggf. weitere Biomarker.
- Weiterführende diagnostische Maßnahmen sollten auf der Grundlage der Anamnese und der Untersuchung der Patienten durchgeführt werden, insbesondere bei Patienten mit langandauernder und/oder unkontrollierter Erkrankung.
Was tun?
Die Therapie umfasst laut S3-Leitlinie allgemeine und medikamentöse Maßnahmen.
Allgemeine Maßnahmen:
- wenn möglich, Triggerfaktoren meiden
- Hautpflege: rückfettende Pflegeprodukte verwenden
- Aufklärung: Eltern und Betroffene über die chronische Natur der Erkrankung informieren.
Medikamentöse Therapie:
Die Erstlinientherapie besteht in der Gabe von H1-Antihistaminika der 2. Generation (nicht sedierend) wie Cetirizin, Levocetirizin, Loratadin, Desloratadin, Ebastin, Fexofenadin, Rupatadin oder Bilastin.
- Dosierung: Standarddosis je nach Gewicht und Präparat
- Steigerung: bei unzureichendem Ansprechen Dosiserhöhung bis zur vierfachen Standarddosis möglich
Hinweis: H1-Antihistaminika der 1. Generation wie Dimetinden werden aufgrund ihrer zentralnervösen und anticholinergen Nebenwirkungen nicht mehr als Mittel der ersten Wahl empfohlen. Sie können Schläfrigkeit, Konzentrationsstörungen und in seltenen Fällen paradoxe Reaktionen wie Unruhe und Schlaflosigkeit verursachen. Moderne H1-Antihistaminika der 2. Generation bieten ein besseres Sicherheitsprofil und eine spezifischere Wirkung ohne sedierende Effekte. Falls erforderlich, sollte über einen Off-Label-Einsatz informiert werden.
Als Zweitlinientherapie stehen folgende Medikamente zur Verfügung:
- Omalizumab: Biologikum bei schwerer, refraktärer chronischer Urtikaria
- Ciclosporin: Ultima ratio bei Nichtansprechen auf Antihistaminika und Omalizumab
Zur Langzeittherapie nicht empfohlen werden Glukokortikoide: Sie dürfen nur bei schwerem, akutem Verlauf und maximal für wenige Tage eingesetzt werden.
Praktische Hinweise für den Alltag
- Symptomtagebuch führen: zur Identifikation von Auslösern
- Schul- und Kitamanagement: individuellen Notfallplan erstellen
- Notfallset mitführen: bei Patienten mit schwerem Verlauf (Epipen, Antihistaminika)
- Kontrollintervalle einhalten: bei chronischen Verläufen engmaschige ärztliche Betreuung
Weiterführende Informationen: