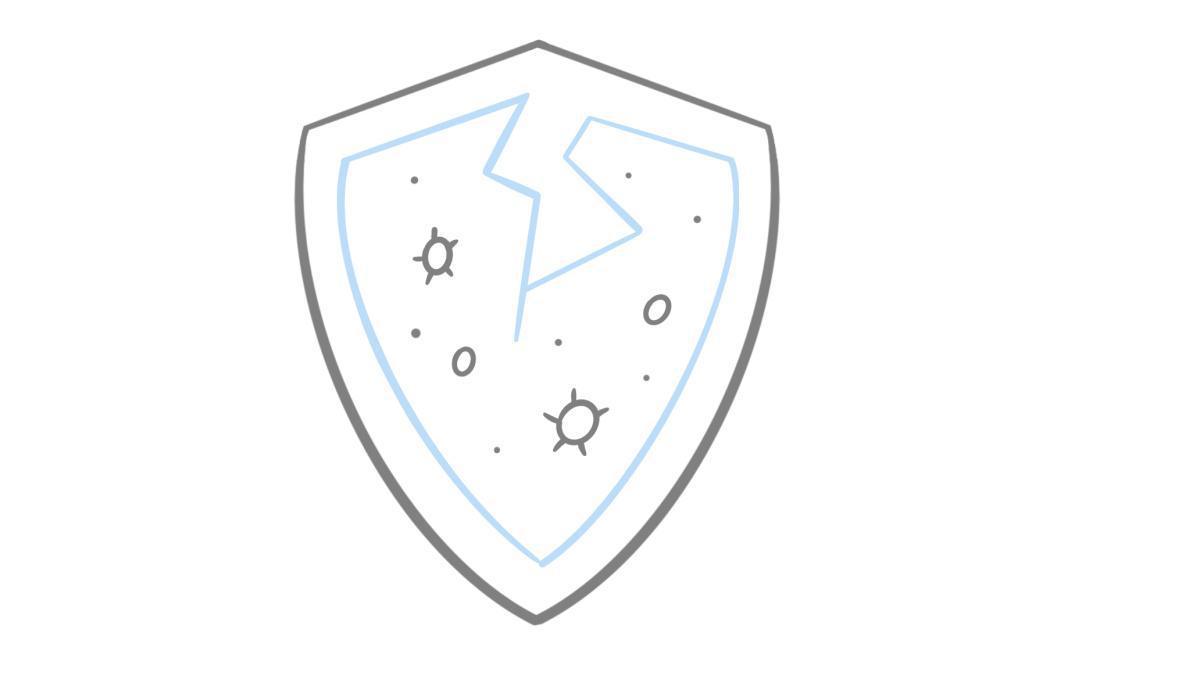Was ist ein primärer Immundefekt?
Ein primärer Immundefekt (PID) ist eine angeborene Störung des Immunsystems, die zu einer erhöhten Anfälligkeit für schwere und atypische Infektionen sowie zu Fehlfunktionen des Immunsystems führt. Neben der Anfälligkeit für bestimmte Infektionserreger treten bei PID häufig zusätzliche immunologische Auffälligkeiten wie eine gestörte Immunregulation auf.
Wann daran denken?
Nicht jede Infektionsanfälligkeit ist ein Hinweis auf einen primären Immundefekt. Besonders bei Kindern sind häufige Infektionen in den ersten Lebensjahren physiologisch. Doch es gibt klare Warnsignale, die auf einen PID hindeuten können. Diese umfassen:
- Infektionen durch opportunistische Erreger: Insbesondere Erreger wie Pneumocystis jirovecii oder CMV, die bei immunkompetenten Personen selten schwere Erkrankungen verursachen, sind ein Warnzeichen.
- atypische Infektionslokalisationen: z.B. durch Aspergillus verursachte Hirnabszesse oder ungewöhnliche Leberabszesse
- protrahierte oder chronische Infektionsverläufe: Infektionen, die auf Standardtherapien nicht ansprechen und einen protrahierten Verlauf zeigen.
- hohe Schwere und Intensität der Infektion: z.B. häufige und schwere Pneumonien, Meningitiden oder Sepsis
- Summe der Infektionen: Verdächtig sind auch persistierende oder über das Maß rezidivierende Minor-Infektionen (z.B. Otitis media, Sinusitis, Bronchitis und oberflächliche Hautabszesse)
Besonders hellhörig sollte man werden, wenn ein Kind wiederholt schwere Infektionen durchmacht, die eine medizinische Intervention erfordern (z.B. häufige stationäre Aufenthalte, wiederholte intravenöse Antibiotikatherapien).
Zusätzlich sollte man bei Anzeichen von einer Immundysregulation besonders achtsam sein, z.B. bei Autoimmunerkrankungen, unerklärlicher Lymphoproliferation (Vergrößerung von Lymphknoten, Milz oder Leber) oder chronischen Darmentzündungen.
ELVIS
Das von Experten entwickelte Akronym „ELVIS“ fasst die wesentlichen Kriterien einer pathologischen Infektionsanfälligkeit zusammen:
- Erreger (seltene oder ungewöhnliche Erreger)
- Lokalisation (schwere oder ungewöhnliche Infektionen)
- Verlauf (chronische oder schlecht ansprechende Infektionen)
- Intensität (schwere Verläufe)
- Summe (häufig wiederkehrende Infektionen).
Wichtig: Hinweise immer kritisch interpretieren, um eine Überdiagnostik zu vermeiden.
Basisdiagnostik
Bei einem begründeten Verdacht auf PID sollte zunächst eine Basisdiagnostik erfolgen, die einfach durchzuführen ist und rasch Hinweise liefert, ob weitere Untersuchungen notwendig sind. Dazu zählen:
- Blutbild mit Differenzialblutbild: Ermittlung der absoluten Anzahl von Leukozyten, Lymphozyten und anderen Blutzellen. Ein Mangel bestimmter Zelllinien (z.B. Lymphozytopenie) kann auf einen Immundefekt hinweisen.
- Bestimmung der Immunglobuline (IgG, IgA, IgM, IgE): Besonders häufige PIDs, wie Antikörpermangelsyndrome (z.B. CVID), sind durch erniedrigte Spiegel bestimmter Immunglobuline gekennzeichnet.
- Bestimmung von Infektionsparametern: Ein dauerhaft erhöhter CRP- oder Leukozytenwert kann auf chronische Entzündungsprozesse hinweisen.
Wichtig: Die Ergebnisse der Basisdiagnostik nicht isoliert, sondern stets im klinischen Zusammenhang interpretieren. Ein auffälliges Blutbild rechtfertigt nicht sofort eine umfangreiche Abklärung, wenn keine klinischen Hinweise auf einen PID vorliegen.
Weiterführende Diagnostik
Sollten die Basisuntersuchungen pathologische Befunde ergeben oder weiterhin starke klinische Hinweise auf einen PID bestehen, kann eine weiterführende Diagnostik durchgeführt werden. Diese umfasst:
- spezifische Immunfunktionstests, z.B. Überprüfung der Antikörperantwort auf Impfungen
- genetische Untersuchungen, insbesondere bei Verdacht auf schwerere angeborene Immundefekte (z.B. SCID)
Wichtig: Immer auf die klinisch relevanten Fälle konzentrieren! Viele Immundefekte zeigen variable Krankheitsverläufe. Nicht jeder genetisch nachgewiesene Defekt führt zu einer schweren Immunstörung.
Überweisung an ein spezialisiertes Zentrum
In komplexeren Fällen oder bei ausgeprägten Hinweisen auf einen Immundefekt ist eine Überweisung an ein spezialisiertes Zentrum ratsam. Dies gilt insbesondere bei:
- schwerwiegender klinischer Symptomatik, die nicht durch häufige Infektionen oder eine andere Ursache erklärbar ist
- fehlender Besserung nach einer angemessenen Therapie
- komplizierten Krankheitsverläufen, wie rezidivierenden schweren Infektionen oder einer Kombination aus Infektionsanfälligkeit und Autoimmunerkrankungen.
Ein spezialisierter immunologischer Ansatz und genetische Tests können dann zur Diagnosesicherung und zur Planung einer gezielten Therapie beitragen.
Vermeidung von Überdiagnostik
Viele Eltern machen sich Sorgen, wenn ihre Kinder wiederholt Infekte haben. Im Kindesalter sind häufige Infekte jedoch in der Regel unbedenklich sind. Es ist wichtig, klar zu kommunizieren, dass nicht jede wiederkehrende Erkältung oder Mittelohrentzündung Anlass für eine umfangreiche immunologische Abklärung ist.
Der Fokus sollte auf schweren und ungewöhnlichen Verläufen liegen. Um eine unnötige Diagnostik und Überweisung zu vermeiden, sollte man unbedingt
- die ELVIS-Kriterien anwenden
- die genaue klinische Symptomatik erfassen
- die familiäre Vorgeschichte berücksichtigen.
Weiterführende Informationen:
S2k-Leitlinie „Diagnostik auf Vorliegen eines primären Immundefekts“ (AWMF 112-001