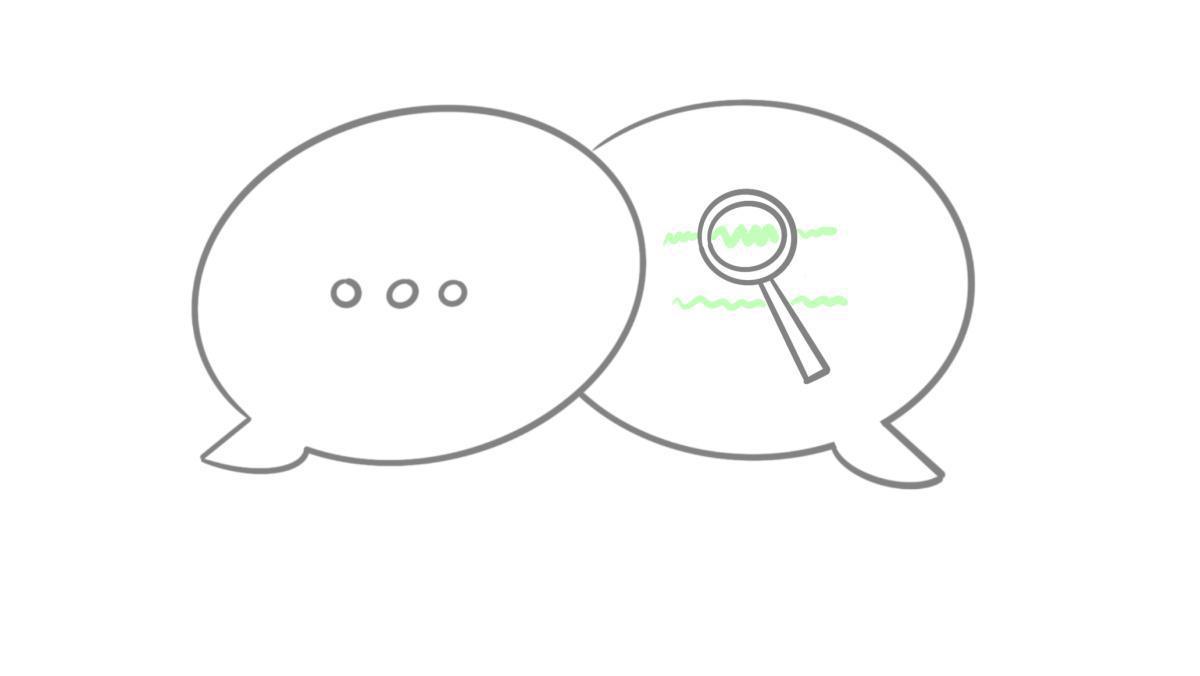Auch in der Sprachdiagnostik und Sprachtherapie ist es wichtig, sich auf das Notwendige zu beschränken. Eine gute Empfehlung für den Patienten ist das eigentliche Ziel, das auf umfangreichem Sachwissen und persönlicher Erfahrung basiert. Es ist wichtig, bestimmte Maßnahmen zu ergreifen oder zu unterlassen, je nachdem, was für den Patienten am besten ist.
Die Sprachentwicklung eines Kindes sollte im Kontext seiner gesamten Entwicklung und Umgebung betrachtet werden. Eine isolierte Beurteilung durch Tests kann die Realität des Kindes nicht vollständig erfassen. Daher ist es wichtig, dass die Diagnose durch den Kinder- und Jugendarzt gestellt wird.
FRAKIS-K-Screening
Das FRAKIS-K-Screening ist ein empfohlenes Instrument für eine effektive Sprachdiagnostik im Kindesalter. Es wird insbesondere bei Bedenken bezüglich der Sprachentwicklung eingesetzt, zum Beispiel wenn das Kind wenig oder gar nicht spricht. Eine erneute Überprüfung wird zwischen dem 28. und 30. Monat empfohlen. Sollten keine signifikanten Fortschritte erkennbar sein, werden die Eltern erneut zur Förderung der Sprach- und kognitiven Entwicklung des „Late Talkers“ beraten. Eine weitere Überprüfung mit 36 Monaten ist sinnvoll, um über mögliche Sprachtherapien zu entscheiden.
Diagnosestellung
Eine Sprachentwicklungsstörung wird diagnostiziert, wenn der Spracherwerb mit 36 Monaten unterhalb der Norm für 30 Monate alte Kinder liegt. Die gängigen Sprachtests (SET-K 3–5, SET 3–5, SBE-3-KT) sind nur bedingt aussagekräftig. Bessere Methoden zur Erkennung einer Therapiebedürftigkeit sind Spontansprachanalysen (informelles Verfahren, Bilderbuch), das Beobachten des Spielverhaltens (Symbolspiel) und die Berücksichtigung des familiären Umfelds.
Kritische Betrachtung von Sprachtests
Bei der Verwendung von Sprachtests in der Kinderheilkunde und -therapie ist es wichtig, eine kritische Perspektive einzunehmen. Solche Tests folgen oft standardisierten Algorithmen und können dadurch eine scheinbare Effizienz und Qualität suggerieren. Dies kann dazu führen, dass die Norm zum Ideal erhoben und der individuelle Patient (das Kind) an diese Norm angepasst wird. Die Professionalität im Gesundheitswesen sollte jedoch nicht allein auf der Befolgung von Schemata basieren. Sprachtests vereinfachen oft die komplexe Realität der Spontansprache, da sie hochkomplexe Zusammenhänge in vereinfachter Form darstellen.
Wichtig: Man sollte keine allzu große Testgläubigkeit entwickeln und stets eine kritische Distanz zu diesen Instrumenten wahren.
KiTa und Schule
Bei der Beurteilung eines Kindes mit Verdacht auf Entwicklungsstörungen ist die Einbindung von KiTas und Schulen unerlässlich. Es ist wichtig, konkrete Einblicke zu erhalten, in welchen spezifischen Situationen das Kind Schwierigkeiten hat. Zudem ist es hilfreich zu verstehen, welche Fähigkeiten das Kind entwickeln muss, um diese Herausforderungen zu bewältigen, und warum pädagogische Maßnahmen allein möglicherweise nicht ausreichen. Die Beobachtungen und Einschätzungen von Lehrkräften und Erziehern sind für die Entscheidungsfindung bezüglich einer Therapie von großer Bedeutung. Insbesondere die Kommunikation zwischen Eltern und Kind spielt hierbei eine wichtige Rolle.
Mehrsprachigkeit
Es gibt keine standardisierten Verfahren zur Identifizierung von Sprachentwicklungsstörungen bei mehrsprachigen Kindern, da es keine allgemeingültigen Normdaten für die Sprachentwicklung in Mehrsprachigkeit gibt. Eine objektive Testung gestaltet sich aufgrund der unterschiedlichen Spracherfahrungen und soziokulturellen Hintergründe dieser Kinder schwierig. Daher ist es nicht eindeutig festzulegen, wann genau ein mehrsprachiges Kind eine Therapie benötigt und wann nicht.
Merke: Mehrsprachigkeit stellt kein hohes Risiko für Sprachstörungen dar.