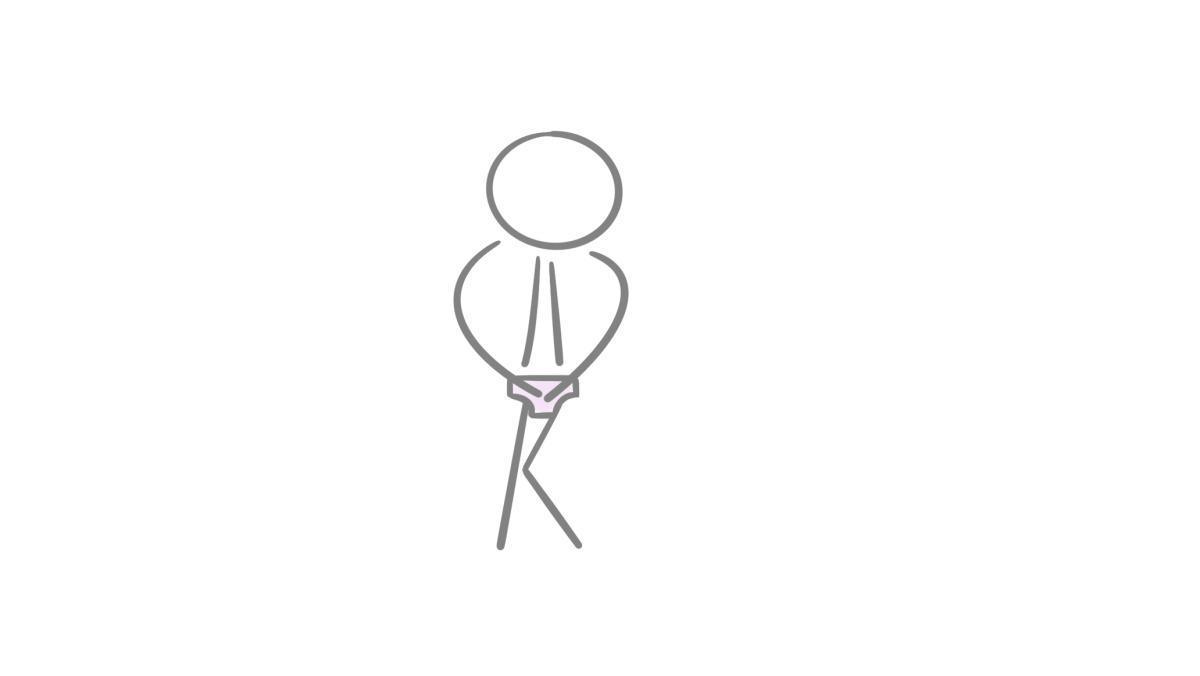Harninkontinenz tritt tagsüber auf. Bei Kindern zeigt sie sich meist als intermittierendes (zeitweiliges) Einnässen. Die Harninkontinenz ist oft funktioneller Natur, also nicht auf körperliche Erkrankungen zurückzuführen. Bis zum Alter von fünf Jahren gilt Einnässen im Wachzustand und im Schlaf als normal.
Die Diagnose erfolgt, wenn das Einnässen mehrere Monate anhält, abhängig vom Alter des Kindes. Es gibt zwei Haupttypen:
- primäre Inkontinenz: besteht seit der frühesten Kindheit
- sekundäre Inkontinenz: tritt auf, wenn ein Kind nach einer Trockenphase wieder anfängt einzunässen
In der Behandlung von Harninkontinenz im Kindesalter werden drei häufige Formen unterschieden:
- idiopathische Dranginkontinenz
- Inkontinenz bei Miktionsaufschub
- dyskoordinierte Miktion
Idiopathische Dranginkontinenz
Bei der idiopathischen Dranginkontinenz erleben die Kinder einen plötzlichen und starken Harndrang. Die Blase lässt sich in diesem Fall nicht passiv füllen, da sich der Detrusormuskel (Austreiber) in der Blasenwand bereits bei geringen Füllmengen zusammenzieht. Die Blase signalisiert somit fälschlicherweise, dass sie voll ist. Dies führt dazu, dass Kinder häufig und sehr plötzlich auf die Toilette müssen. Eine solche Blasenüberempfindlichkeit kann metaphorisch als „Prinzessinnen- bzw. Prinzenblase“ beschrieben werden. Eltern können dieses Verhalten oft missverstehen und denken, das Kind spiele nur Spielchen, weil es trotz des dringenden Harndrangs nur geringe Urinmengen ausscheidet.
Miktionsaufschub
Miktionsaufschub tritt auf, wenn Kinder den Harndrang bewusst ignorieren, um eine Aktivität, die sie gerade ausführen, nicht zu unterbrechen. Dieses Verhalten wird bei Kindern beobachtet, die etwa intensiv mit Legosteinen spielen, am Computer sitzen oder anderen Hobbys nachgehen. Ein weiteres Beispiel ist ein Kind, das das Erste in der Hofpause sein möchte und deswegen nicht zur Toilette geht. Diese Kinder sind sich ihres Harndrangs bewusst, entscheiden sich jedoch aktiv dagegen, zur Toilette zu gehen, da sie andere Dinge als wichtiger erachten. Als Folge gehen sie insgesamt seltener am Tag auf die Toilette, was zu großen Miktionsvolumina führt, wenn sie schließlich urinieren. Zum gelegentlichen Einnässen kommt es, da die Blase überläuft.
Dyskoordinierte Miktion
Bei der dyskoordinierten Miktion liegt eine mangelnde Koordination zwischen den beiden wesentlichen Muskeln der Blase vor, nämlich dem Sphinkter (Schließmuskel) und dem Detrusor (Austreiber).
Der Sphinkter ist der Muskel, der sich während der Blasenentleerung öffnen sollte, während der Detrusor, der in der Blasenwand liegt, sich kontrahieren und die Blase ausdrücken sollte.
Bei dyskoordinierter Miktion entspannt sich der Sphinkter jedoch nicht richtig, sondern bleibt geschlossen, während der Detrusor gegen den erhöhten Druck des geschlossenen Sphinkters drückt. Das Resultat ist, dass Kinder den Urin nicht in einem kontinuierlichen Strahl ausscheiden können, sondern nur portionsweise. Oft verbleibt Restharn in der Blase. Dies kann zu organischen Komplikationen wie Harnwegsinfektionen führen.
Die betroffenen Kinder berichten oft von einem Gefühl beim Urinieren pressen zu müssen, ähnlich wie beim Stuhlgang. Sie beschreiben den Urinfluss als unterbrochen oder portioniert, was ein charakteristisches Merkmal dieser Störung ist. Solche Kinder haben oft Schwierigkeiten, ihre Blase vollständig zu entleeren, was zu wiederholtem Drang führt, kurz nachdem sie bereits auf der Toilette waren.
Was tun?
Kommunikation
Wichtig ist die Kommunikation über das Thema. Oft möchten Eltern über Ausscheidungsstörungen sprechen, ohne dass das Kind anwesend ist, aber es ist entscheidend, dass auch mit dem Kind darüber gesprochen wird. Es sollte eine gemeinsame Sprache gefunden werden, die von der Familie und dem Kind gleichermaßen verwendet wird. Das Thema sollte enttabuisiert werden, um eine offene Kommunikation zu ermöglichen. Hilfreich dabei können Bilderbücher sein, die das Thema in einer kindgerechten und zugänglichen Weise behandeln.
Therapie der Dranginkontinenz
Bei der Behandlung von Dranginkontinenz bei Kindern ist die Psychoedukation ein wichtiger Bestandteil. Das sog. Blasenretentionstraining, bei dem Kinder angehalten werden, ihren Harndrang zu unterdrücken, wird heute hingegen als nicht hilfreich und sogar potenziell schädlich angesehen. Stattdessen wird den Kindern beigebracht, sofort auf die Toilette zu gehen, wenn sie das Bedürfnis verspüren. Dieser Ansatz hilft, das Problem zu entschärfen, ohne dass Medikamente notwendig sind.
In Fällen von ausgeprägter Dranginkontinenz können Medikamente wie Propiverin oder Oxybutynin hilfreich sein, welche die Blasenmuskulatur entspannen lassen.
Merke: Diese Medikamente sind besonders bei Drangsymptomatik sinnvoll, während sie bei nächtlichem Einnässen ohne Drangsymptomatik kaum einen Nutzen haben.
Ein weiterer Aspekt ist die Aufklärung und das Gespräch mit dem Kind über seine Ausscheidungsfunktionen. Hierbei sollte eine kindgerechte und familienfreundliche Sprache verwendet werden. Eltern sollten zudem ermutigt werden, auf die Bedürfnisse ihres Kindes einzugehen und dieses nicht dazu anzuhalten, den Harndrang zu ignorieren, insbesondere auf langen Autofahrten oder in anderen Situationen, in denen das Kind nicht sofort Zugang zu einer Toilette hat.
Therapie von Miktionsaufschub
Die betroffenen Kinder sollten regelmäßige Toilettengänge in den Tagesablauf integrieren. Statt auf akustische Erinnerungen wie Wecker oder Handysignale zu setzen, empfiehlt es sich, Toilettengänge an natürliche Gelegenheiten im Tagesablauf anzupassen. Beispiele dafür sind der Gang zur Toilette morgens nach dem Aufstehen, vor dem Verlassen des Hauses, vor Pausen, nach der Rückkehr vom Hort, vor dem Spielen oder Sport und vor dem Schlafengehen. Diese Routine hilft, ein natürliches Miktionsmuster zu etablieren.
Eltern sollten ihre Kinder zu bestimmten Zeiten zur Toilette „schicken“, anstatt zu fragen, ob sie müssen, da Kinder mit Miktionsaufschub oft verneinen, um ihre Aktivität nicht zu unterbrechen. Ein direkteres Vorgehen verhindert Diskussionen und fördert eine gesunde Miktionsroutine. Diese Herangehensweise ist vergleichbar mit anderen alltäglichen Routinen wie Händewaschen vor dem Essen oder Zähneputzen danach. Es geht darum, klare Regeln zu etablieren, anstatt das Kind zu fragen, ob es die Toilette nutzen möchte, ähnlich wie man ein Kind an einer roten Ampel auch nicht fragt, ob es stehen bleiben möchte.
Therapie der dyskoordinierten Miktion
Hier kann im Rahmen einer speziellen Urotherapie eine Biofeedbackbehandlung mit optischen oder akustischen Signalen durchgeführt werden, wenn Kinder bzw. Jugendliche und Eltern für die Behandlung motiviert sind.